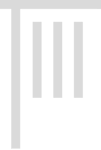Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 11. Oktober 2024 (Az. V ZR 22/24) befasst sich mit der Frage, ob ein Gedenkstein im gemeinschaftlichen Ziergarten einer Wohnungseigentumsanlage aufgestellt werden darf.
Gedenken an verstorbenen Wohnungseigentümer
In einer Wohnungseigentumsanlage wurde beschlossen, im gemeinschaftlichen Ziergarten einen Gedenkstein für einen verstorbenen ehemaligen Bewohner und Oberbürgermeister der Stadt aufzustellen. Eine Wohnungseigentümerin erhob dagegen Klage mit der Begründung, der Stein habe einen grabsteinähnlichen Charakter und vermittle in Kombination mit der hinter dem Garten liegenden Kirche einen friedhofsähnlichen Eindruck, was sie als störend empfand.
Gedenkstein nicht gleich Grabstein
Der BGH entschied, dass die Aufstellung des Gedenksteins zulässig ist. Er stellte fest, dass ein Ziergarten, der der Schönheit dienen soll, grundsätzlich auch Skulpturen enthalten kann. Ein künstlerisch gestalteter Gedenkstein, der optisch einem Grabstein ähnelt, widerspricht nicht dem Charakter eines Ziergartens, insbesondere wenn es sich um ein einzelnes Element handelt und der Garten weiterhin zur Erholung genutzt werden kann.
Zudem führte der BGH aus, dass die benachbarte Bebauung, hier die Kirche, nicht in die Bewertung einbezogen werden kann, da sie ohnehin vorhanden ist und den Eindruck des Gartens unabhängig vom Gedenkstein prägt. Auch eine unbillige Benachteiligung der klagenden Eigentümerin liegt nicht vor, da bei der Beurteilung objektive Maßstäbe anzulegen sind und subjektive Empfindungen nicht ausschlaggebend sind.
Weites Ermessen der Wohnungseigentümer
Mit diesem Urteil stärkt der BGH die Entscheidungsbefugnis der Wohnungseigentümergemeinschaften bei der Gestaltung gemeinschaftlicher Flächen und stellt klar, dass die Aufstellung eines Gedenksteins im Ziergarten zulässig sein kann, sofern keine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage erfolgt und keine unbillige Benachteiligung einzelner Eigentümer vorliegt.